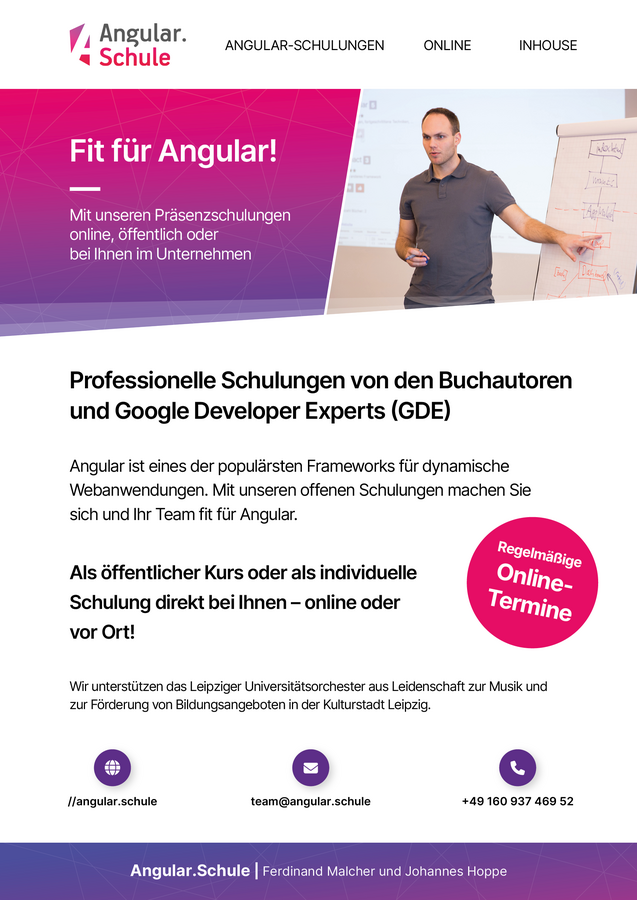Herzlich willkommen zum Semesterkonzert des Leipziger Universitätsorchesters im Wintersemester 2024/2025!
Leipziger Universitätsorchester
Leitung: Daniel Seonggeun Kim
01.02.2025, 18:00 Uhr
Gewandhaus, Großer Saal
Konzerteinführung um 17:15 Uhr im Schumann-Eck
Programm
Sergej Prokofjew (1891–1953)
Suite aus Romeo und Julia op. 64b
I. Die Montagues und die Capulets
II. Julia als junges Mädchen
III. Pater Lorenzo
IV. Tanz
V. Romeo und Julia
VI. Tybalts Tod
VII. Romeo und Julia vor ihrer Trennung
VIII. Tanz der Mädchen von den Antillen
IX. Romeo am Grab Julias
(Sätze V und VI aus Suite Nr. 1, alle anderen Sätze aus Suite Nr. 2)
– Pause –
Pjotr Iljitsch Tschaikowski (1840–1893)
Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64
I. Andante – Scherzo (Allegro con anima)
II. Andante cantabile, con alcuna licenza
III. Walzer. Allegro moderato
IV. Finale. Andante maestoso – Allegro vivace (Alla breve) – Meno mosso
Werkeinführung
Suite aus 'Romeo und Julia'
William Shakespeares Romeo und Julia ist das wohl bekannteste Drama der Theatergeschichte. Die 1935 komponierte Ballett-Vertonung von Sergej Prokofjew erreichte ebenfalls eine herausragende Bedeutung und ist heute zusammen mit dem Musikmärchen Peter und der Wolf das meistgespielte Stück des russischen Komponisten und eines der erfolgreichsten Ballette überhaupt. Ein Erfolg, der sich nicht unmittelbar abzeichnete: Als sich Prokofjew 1935 im Bolschoi-Theater in Moskau ans Klavier setzte, um seine Musik vor den versammelten Tänzern, Choreographen und Dirigenten zu präsentieren, stieß er auf Unverständnis. „Je länger er spielte, umso mehr lichteten sich die Reihen der Zuhörer. Die meisten verstanden überhaupt nichts. Viele meinten, dass zu einer solchen Musik unmöglich getanzt werden könne.“, berichtete der Dirigent Juri Fayer.
Diese Anekdote fügt sich ein in eine Reihe von Start-Schwierigkeiten, die das Stück in den ersten Jahren begleiteten – zur Uraufführung kam es erst 1938 in Tschechien, in Russland sogar erst 1940. Vielleicht entschied sich Prokofjew deshalb dazu, bereits vor der Aufführung des Balletts das musikalische Material in zwei sinfonischen Suiten zusammenzustellen: „Ich formte aus dem Ballett zwei sinfonische Suiten mit je sieben Sätzen. Die Suiten folgten einander nicht in der Reihenfolge der Handlung, sondern gingen zum Teil einander parallel.“ Auf diese Weise konnte Prokofjew die Musik, unabhängig von organisatorischen und dramaturgischen Schwierigkeiten des Balletts, bereits einem breiten Publikum vorstellen.
Heute Abend ist eine Kombination dieser beiden Suiten zu hören: Zwischen der vierten und fünften Nummer der Suite Nr. 2 (heute Abend Nummer IV und VII) werden die beiden letzten Sätze der ersten Suite gespielt (V und VI).
Zu Beginn steht der berühmte Tanz der Ritter, dessen starke, teils aggressive Thematik die Feindschaft der Familien Montague und Capulet verkörpert. Die Nummern II und III sind Charakter-Stücke: Die aufgeweckten und frechen Läufe stehen für die junge Julia, der besinnliche Grundton für den stets verständnisvollen Pater Lorenzo. In der vierten Nummer kommt es zu einem fröhlichen und schwungvollen Tanz zwischen Romeo und Julia, der stellvertretend für einen anfangs hoffnungsvollen Blick auf die gemeinsame Zukunft steht.
Anschließend der Sprung zur Nummer 6 der Suite Nr. 1 (V): Die zu Beginn zarten Klänge werden im Laufe der Nummer immer voller und mitreißender – hören wir hier im Laufe der Nummer dem sinnlichen Erwachen der Liebe zwischen Romeo und Julia bei ihrer ersten Begegnung zu? Die Nummer 7 (VI) („Tybalts Tod“) bringt schließlich den tragischen Wendepunkt in der Geschichte: Nachdem Romeo den Tod seines Freundes Mercutio rächt und Tybalt – Julias Cousin – umbringt, scheint die jugendliche Liebe an der Feindschaft der beiden Familien gescheitert.
Der nahende Abschied der beiden Liebenden ist in der folgenden Nummer 5 der zweiten Suite (VII) zu hören. Das zu Beginn noch liebliche Thema wird in der Mitte durch ein stürmisches Gegenmotiv aufgewühlt, bevor die Nummer deutlich dissonanter als zu Beginn endet. Die kurze vorletzte Nummer („Tanz der Brautjungfern“) zeigt das Talent Prokofjews, in seiner Musik die verschiedensten dramatischen Ebenen hervortreten zu lassen. Der Tanz für sich wirkt zunächst wie eine sanfte Antithese zur Dramatik der vorangegangenen Handlung, doch verbindet sich mit ihm ein kaum beschreibbares Gefühl der Beklemmung, das dem Gefühl Julias angesichts ihrer bevorstehenden ungewollten Vermählung mit Paris entsprechen dürfte. Und erinnern wir uns zurück an das erste Aufeinandertreffen von Romeo und Julia, das ebenfalls im Rahmen eines Tanzes stattfand: Nun erscheint das scheinbar liebliche Zwischenspiel als transzendentale Erfahrung des Verlorenen, als leere Hülle, die Julias Liebe nur als weit entferntes Echo widerklingen lässt. Die finale Nummer („Romeo an Julias Grab“) beginnt mit einem herzzerreißenden Motiv der Violinen, einem letzten verzweifelten Aufschrei Romeos, der Julias (scheinbar) toten Körper findet. Der weitere Verlauf der Handlung ist allseits bekannt – und nach dem wohl berühmtesten Missverständnis aller Zeiten liegen die beiden Liebenden leblos am Boden. Die Musik verklingt schließlich in ergreifendem Schweigen.
Luca Rummel
Ruhm und Schicksal: Tschaikowskis 5. Sinfonie
Der Prozess des Zweifelns ist häufig negativ konnotiert. Dabei ist Zweifeln beispielsweise in der Wissenschaft ein essenzieller Motor neuen Erkenntnisgewinns. Auch in der klassischen Musik kann man aus dem Stand eine Reihe von notorischen Zweifler:innen nennen – etwa Beethoven oder Bruckner – die gleichzeitig mit ihrer Musik bahnbrechende Neuerungen erschufen. Disziplinenübergreifend hält Friedrich Nietzsche im Antichrist fest: „Große Geister sind Skeptiker.“ Auch Pjotr Tschaikowski reiht sich in diese Liste „großer Geister“ ein. Zeit seines Lebens war sein kompositorischer Prozess von Selbstkritik geprägt, besonders aber im Zuge seines Spätwerks. Immer häufiger sorgte er sich, er habe keine neuen Gedanken und Stimmungen mehr, um überhaupt weiter zu komponieren. Und das, obwohl seine äußeren Lebensumstände zu dieser Zeit langfristig auf hohem Niveau gesichert schienen. So war er durch Zuwendungen seiner (Brief-)Freundin Nadeschda Filaretowna von Meck und ab 1888 durch eine jährliche Rente des Zaren Alexander III. finanziell gut situiert. Seine Kompositionen setzten sich auf internationaler Ebene durch und erhielten bedeutende Preise. Ende 1887 trat er seine erste große Konzerttournee durch die Musikmetropolen Europas an. Trotzdem sind seine Tagebücher von Rat- und Hoffnungslosigkeit durchzogen. Nach dieser kräftezehrenden Reiseerfahrung machte sich Tschaikowski an die Komposition eines neuen Werkes: seiner 5. Sinfonie.
Zu Beginn des Kompositionsprozesses im Mai 1888 notierte Tschaikowski in ein Notizbuch ein Programm für den ersten Satz: „Introduktion. Völlige Ergebung in das Schicksal oder, was dasselbe ist, in das unergründliche Walten der Vorsehung. Allegro I) Murren, Zweifel, Klagen, Vorwürfe gegen ... II) Sollte man sich nicht in die Arme des Glaubens werfen??? Ein wunderbares Programm, wenn es sich nur ausführen ließe.“ Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts lodert in der klassischen Musik die Auseinandersetzung zwischen „absoluter Musik“ und „Programmmusik“. Dieser Unterscheidung schließt sich Tschaikowski nicht an, er unterscheidet einzig die Quelle der musikalischen Inspiration – subjektiv gegen objektiv –, denn aller ernsten Musik liegt auch ein Programm zugrunde, auch wenn man es nicht immer in Worte fassen kann. Im Fall der 5. Sinfonie liegt somit eine subjektive Inspiration vor. Das eben genannte Zitat „völlige Ergebung an das Schicksal“ bescherte der Sinfonie den programmatischen Namen „Schicksalssinfonie“, den sie bis heute häufig trägt. Doch diese Fokussierung wird dem vielfältigen Ausdruck, der dem Werk zugrunde liegt, nicht gerecht.
Die Sinfonie hat einen zentralen Kern, eine musikalische Idée fixe. Das rhythmisch punktierte Thema öffnet und schließt das Werk. Die Idée fixe ist in ihrer wiederkehrenden Gestalt entscheidend für die Umsetzung des Grundgerüsts der 5. Sinfonie, einem sinfonischen Zyklus. Alle Sätze und musikalischen Einheiten des Stücks sind miteinander verknüpft. In der langsamen Einleitung stellen die Klarinetten die Idée fixe in tiefer Lage mit dunkler Streicherbegleitung vor. Der anschließende Allegro-Teil steht in freier Sonatenhauptsatzform und verarbeitet das Material dreier Themen. Die Musik nimmt immer wieder über lange Phrasen rhythmischer Prägnanz Fahrt auf, hetzt sich ab, um dann in elegischen Seitenthemen zu zerfließen. Der erste Satz schließt nach wildem Höhepunkt im ppp und baut so die Brücke zum Beginn des zweiten Satzes. Das Andante cantabile beginnt aus einer tiefen Harmonieabfolge der Streicher, auf die sich das Solo-Horn setzt, um das Publikum mit einer ausgedehnten Melodie in die Arme zu schließen. Die Melodie wird von anderen Instrumenten aufgenommen, der Satz verdichtet sich und kommt zum Höhepunkt. Die darauffolgende Ruhe täuscht, nervös baut sich der Satz auf, um die Idée fixe als brutale Trompetenfanfare in den Raum zu stellen. Nach einer Wiederholung des ersten Höhepunkts schneidet die gleiche Trompetenfanfare nochmals jäh in die Stille.
Der dritte Satz, ein eleganter Walzer, ist vor allem von einem detailreichen Ineinandergreifen der Instrumente geprägt. Eine einzelne Melodie läuft über eine weite Strecke durch, wird aber in dieser Zeit von den verschiedenen Instrumentengruppen aufgegriffen und weitergegeben. Ein kleinteiliger B-Teil mit Perpetuum-mobile-Charakter kontrastiert diese Melodieführung; in der Coda lässt Tschaikowski schließlich beide Teile ineinanderlaufen. In den letzten Takten erscheint nun die Idée fixe in den tiefen Holzbläsern und leitet somit zum Beginn des vierten Satzes über. Das Finale stellt zu Beginn die Idée fixe triumphal als Streichermelodie in den Raum, die zögerliche Gestalt des Anfangs weicht der eines siegessicheren Gestus in Dur. Danach hetzt sich das Orchester jedoch ohne Rast von einem Rondo-Teil in den nächsten. Selbst Stellen, die zunächst Ruhe versprechen, schwelen weiter und entflammen unvermittelt. Diese ungeheure musikalische Anstrengung und Spannung explodiert gegen Ende in der Wiederkehr der Idée fixe als triumphale Trompetenfanfare. Doch dabei belässt es Tschaikowski nicht, sondern schließt nochmals eine fast rabiate Stretta an, die den sicheren Triumph der Idée fixe wieder einreißt.
Vor allem dieses Finale wirft Fragen zur Deutung des Werkes auf. Wer gewinnt hier nun, die Zuversicht oder die Hoffnungslosigkeit? Darüber ist so viel spekuliert worden, dass die beste Antwort ist: niemand. So lässt sich auch Tschaikowskis ambivalentes Verhältnis zu dem Stück und dem Finale im Besonderen deuten. War er nach der Uraufführung „überzeugt, dass diese Sinfonie misslungen ist“, änderte er nach einigen Aufführungen seine Meinung zum Positiven: „Das Angenehmste ist, dass die Symphonie aufgehört hat, mir hässlich zu erscheinen; ich habe sie wieder liebgewonnen.“ Ob die Sinfonie mit ihrer Ambivalenz auch ein Spiegel von Tschaikowskis Selbst ist, lässt sich nicht abschließend beurteilen. Mutmaßen darf man jedoch, vor allem im Kontext dieses Zitats: „Und unser Ich wird, in Musik übersetzt, nicht mehr sein können als eine Idée fixe im Sinne Berlioz.“
Frederik Falk
Mitwirkende
Das Leipziger Universitätsorchester wurde im Oktober 2003 von Studierenden verschiedenster Fachrichtungen als »Leipziger Studentisches Orchester« gegründet. Die ersten Proben fanden Anfang November im Krochhochhaus am Augustusplatz statt. Später etablierte sich die Mensa am Campus Jahnallee als Probenort. Am 15. Januar 2004 fand das Gründungskonzert unter der Leitung von Norbert Kleinschmidt im Mendelssohn-Saal des Gewandhauses statt. Mit Bartóks Rumänischen Volkstänzen, Mozarts 1. Flötenkonzert und Haydns 104. Sinfonie trat das Orchester erstmals an die Öffentlichkeit. Am 13. Februar 2004 bestätigte das Rektorat die Zusammenarbeit mit dem Klangkörper, der sich seither »Leipziger Universitätsorchester« (LUO) nennt. Bereits das folgende Konzert konnte mit 74 Mitwirkenden im Großen Saal des Gewandhauses stattfinden – nun unter der Leitung von Anna Shefelbine, die im ersten Probedirigat gewählt worden war. Durch die Anbindung an die Leipziger Universitätsmusik konnte dem Orchester entscheidende Infrastruktur ermöglicht werden. Ebenfalls im Jahr 2004 begann die dauerhafte finanzielle Unterstützung durch den StudentInnenrat der Universität. Zudem nahm schon damals die enge und vielgestaltige Kooperation mit dem MDR-Sinfonieorchester ihren Anfang, dessen Mitglieder als Dozierende bis heute die Stimmproben leiten.
Das Aushängeschild des Leipziger Universitätsorchesters war und ist seine konsequent durchgeführte demokratische Selbstverwaltung. Jedes einzelne Orchestermitglied hat auf allen organisatorischen Ebenen ein Mitspracherecht und kann persönliche Ideen und Meinungen einbringen. Grundsätzliche Entscheidungen werden von der Vollversammlung aller Mitglieder getroffen. Orchestervorstand, Dirigent*in und musikalisches Programm werden vom Plenum gewählt und bestätigt. Ebenso entscheidet das Orchester in Probespielen demokratisch über die Aufnahme neuer Mitglieder. Diese ist immatrikulierten Studierenden vorbehalten – die daraus resultierende Fluktuation sorgt beständig für neue Impulse und garantiert Offenheit und Teilnahmemöglichkeiten.
Die Freude am gemeinsamen Musizieren und steter Ehrgeiz und Mut haben das Orchester sicher durch zwei Jahrzehnte geführt. Zu den Höhepunkten der Orchestergeschichte zählen Konzertreisen nach Italien, Brüssel/Lille, in die Niederlande und nach Löwen, Kooperationskonzerte mit dem MDR-Sinfonieorchester und -Kinderchor sowie der HR-Bigband und die Entstehung von zwei Dokumentarfilmen. Beständig wurde neues Repertoire erschlossen, so u. a. Sinfonien von Dvořák, Mahler, Brahms, Sibelius, Schostakowitsch, Prokofiev, Elgar, Tschaikowsky, Nielsen, Borodin, Berlioz und Beethoven, daneben zahlreiche Solokonzerte, Tondichtungen und Ouvertüren, aber auch Chorwerke wie Brittens War Requiem oder Mendelssohns Die erste Walpurgisnacht.
In der Nachfolge von Juri Lebedev, Kiril Stankow, Raphael Haeger, Frédéric Tschumi und Ilya Ram liegt die musikalische Leitung seit 2024 in den Händen von Daniel Seonggeun Kim. Nach der Pandemiezeit startete das LUO mit gewohntem Optimismus neu. Schon im Sommer 2022 wurde beim European Student Orchestra Festival in Toulouse ein musikalisches Zeichen gesetzt und der Orchestergeist neu entfacht. Mit der Gewandhaus-Erstaufführung der e-Moll-Sinfonie von Amy Beach, Bruckners Siebter und Saint-Saëns’ »Orgelsinfonie« wagte sich das Orchester auch seither an ambitionierte Literatur. Die Gründung eines Projektchores zur Aufführung der Sea Symphony von Ralph Vaughan Williams im Rahmen des Jubiläumskonzerts im Januar 2024 darf für die ungebrochene Motivation und Organisationsleidenschaft des Orchesters stehen.
Zum aktuellen Semesterkonzert zählt das LUO 90 Mitspielende. Seit der Eröffnung der Aula und Universitätskirche Paulinum finden die Proben dort statt, im Wechsel mit dem vom MDR großzügig zur Verfügung gestellten Orchesterprobensaal. Eine studentische Hilfskraft in der Universitätsmusik, wichtige Sponsoren und ein Förderverein unterstützen die komplett ehrenamtliche Arbeit der Mitglieder.
Neben den regulären Semesterkonzerten gestaltet das Orchester jedes Semester ein Schulkonzert, einen Kammermusikabend sowie das Format »Auftakt« mit kleineren sinfonischen Werken. Selbstverständlich steht der gesellige Aspekt gleichfalls im Fokus, sei es beim Zusammensein nach Proben oder auf dem Probenwochenende, beim Running Dinner oder in den andauernden Freundschaften, die unter den Orchestermitgliedern entstehen. In ihnen leben die ersten 20 Jahre LUO vielerorts fort.
Niklas Schächner
Daniel Seonggeun Kim
Der Dirigent Daniel Seonggeun Kim ist der 1. Preisträger des 12. Dirigierwettbewerbs der mittdeutschen Musikhochschulen und seit April 2024 neuer Chefdirigent des Leipziger Universitätsorchesters. Er begann im April 2018 sein Bachelorstudium im Fach Orchesterdirigieren an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, das er im Frühjahr 2022 mit Auszeichnung abschloss, und studiert derzeit im Konzertexamen an derselben Hochschule bei Prof. Nicolás Pasquet und Prof. Ekhart Wycik.
Im Rahmen seiner Ausbildung arbeitete er mit zahlreichen professionellen Orchestern wie dem MDR Sinfonieorchester, der Jenaer Philharmonie, der Staatskapelle Weimar, der Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach, der Anhaltischen Philharmonie Dessau, dem Sinfonieorchester Karlovy Vary und der Philharmonie Hradec Králové.
Unter anderem assistierte Daniel Kim dem Generalmusikdirektor Markus L. Frank bei Alexander Zemlinskys Oper "Der König Kandaules" am Anhaltischen
Theater Dessau. In der Spielzeit 23/24 assistierte er dem Chefdirigenten Domink Beykirch bei der Neuproduktion "Capuleti e i Montecchi" am Deutschen Nationaltheater Weimar.
Von Herbst 2019 bis Frühjahr 2023 war er künstlerischer Leiter des Collegium Musicum Weimar, dem offiziellen Hochschulensemble der HfM Weimar, mit dem er ein vielfältiges sinfonisches Repertoire zum Klingen bringt. Darüber hinaus leitete er mehrfach als Gastdirigent das Akademische Orchester Erfurt. Seit 2023 ist er Stipendiat im Forum Dirigieren des Deutschen Musikrates.
Besetzung
Violine 1
Antonia Andrae
Anna-Clara Bachmann
Anne-Sophie Bruchmüller
Anne Clasen (Konzertmeisterin)
Susanne de Boor
Helen Djalali
Marius Drobisz (Konzertmeister)
Jakob Härtel
Annika Helms
Charlotte Herold
Jonathan Jopp
Marie-Luise Kruopis
Daniel Negreanu
Anna Roth
Clara-Josephine Staemmler
Anne Sophie Timm
Violine 2
Agnes Berbée
Katharina Domsgen
Anna Jung
Leora Koch
Knut Nierhaus
Sina Pletsch
Magdalena Rambau
Julius Schilling
Caroline Schweiker
Merle Welten
Friedrich Raff
Elli Ludwig
Kathi Meyer
Luca Rummel
Viola
Wieland Bicher
Edna Brox
Lea Fucks
Johanna Fremerey
Charlotte Henke
Katharina Josy
Helena Morgner
Friederike Müller
Johanna Spitzer
Luise Stoll
Carlotta Rothenfusser
Elisa Olbrich
Violoncello
Berenike Beckhaus
Paula Eschenburg
Frederik Falk
Jan Arne Friedrich
Klara Funfack
Clara Jung
Friederike Kollmar
Richard Schmidt
Marie Luise Stephan
Philipp Heise
Nadja Unger
Juliane Wiedersberg
Kontrabass
Julia Heni
Leonhard Weiss
Friedrich Pagenkopf
Johannes Köppl
Lelia Buzalkovski
Javier Carbajal Ferro
Flöte
Lotta Bonni Timmermann
Annalena Buhl
Daniel Charif
Oboe
Johanna Schittenhelm
Jonathan Gorenflo
Leonore Szalai
Klarinette
Till Friedrich Faulhaber
Pepijn Hulsbergen
Angelika Vaihinger
Fagott
Miriam Al-Ali
Charlotte Pannenbecker
Sophia Weißer
Saxophon
Elias Berkay Kurtoglu
Horn
Katharina Dinter
Jakob Grünthaler
Niklas Schächner
Simon Biskupski
Miriam Voltz
Trompete
Erik Fischer
Marleen Groetsch
Jonathan Horn
Posaune
Friedrich Jopp
Maximilian Wiesmann
Samuel Michel
Tuba
Hanwen Xu
Pauke/Schlagwerk
Kaja Hahnheiser
Jakob Riedl
Taewon Yoon
Benjamin Schreier
Harfe
Helene Weiss
Wir danken unseren Unterstützer_innen:
Studentenwerk Leipzig

StuRa der Universität Leipzig

Sinfonieorchester des Mitteldeutschen Rundfunks

Förderverein des LUO

Leipziger Universitätsmusik

Sächsischer Musikrat

saltoflorale

Impressum
Herausgeber: Leipziger Universitätsorchester
Texte: siehe oben
Layout, Satz: Martin Köhler
*Das Leipziger Universitätsorchester übernimmt keine Verantwortung für jegliche Werbe-
anzeigen in diesem Programmheft.